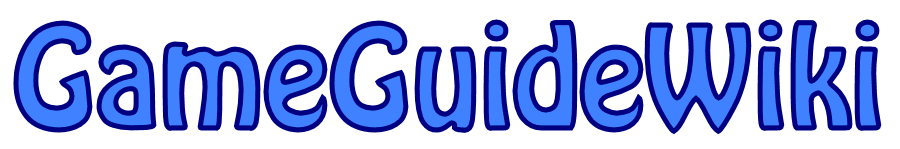Amstrad CPC: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „. “ durch „. “) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Amstrad_CPC464.jpg|thumb|250px|right|Amstrad CPC 464, mit CTM640 Farbmonitor]] | [[Datei:Amstrad_CPC464.jpg|thumb|250px|right|Amstrad CPC 464, mit CTM640 Farbmonitor]] | ||
Die '''Amstrad-CPC'''-Serie, im deutschsprachigen Raum eher als '''Schneider CPC''' bekannt, war eine in den 1980er Jahren populäre Baureihe untereinander weitgehend [[kompatibel|kompatibler]] 8-[[Bit]]-[[Heimcomputer]], die auf der damals weit verbreiteten [[Z80]]-[[CPU]] basierte und u.& | Die '''Amstrad-CPC'''-Serie, im deutschsprachigen Raum eher als '''Schneider CPC''' bekannt, war eine in den 1980er Jahren populäre Baureihe untereinander weitgehend [[kompatibel|kompatibler]] 8-[[Bit]]-[[Heimcomputer]], die auf der damals weit verbreiteten [[Z80]]-[[CPU]] basierte und u. a. in Westeuropa größere Verbreitung fand. Entwickelt wurden die CPCs von der britischen Firma [https://de.wikipedia.org/wiki/Amstrad Amstrad], die sie in Fernost, u. a. von [https://de.wikipedia.org/wiki/Orion_Denki Orion], als Auftragsarbeit bauen ließ. Die Bezeichnung ''CPC'' leitet sich vom englischen '''''C'''olour '''P'''ersonal '''C'''omputer'' ab. | ||
Die [[Rechner]] wurden als Komplettpaket mit umfangreicher [[Hardware]]ausstattung verkauft: Enthalten waren der eigentliche Rechner mit integrierter [[Tastatur]] und [[Laufwerk]] ([[Kompaktkassette]] beim CPC464 und 464Plus, 3″-[[Diskette]] bei den anderen Modellen), ein Farb- oder ein [[Monochrom]]-[[Monitor]] (grün bei den klassischen und schwarzweiß bei den Plus-Modellen) mit integriertem Netzteil, mehrere kurze Verbindungskabel, ein ausführliches Handbuch, eine [[CP/M]]-[[Booten|Bootdiskette]] sowie eine Diskette mit Programmen bzw. eine Demokassette. Ein Fernseher konnte über einen als Zubehör erhältlichen [[Adapter]] angeschlossen werden. Jedoch lieferte der mitgelieferte [[RGB]]-Monitor ein wesentlich besseres Bild als ein Fernseher. Je nach Modell und Ausstattung war der Verkaufspreis vergleichbar oder deutlich niedriger als der eines [[C64]], bei dem Monitor und Disketten-Laufwerk in der Regel als Zubehör erworben werden mussten. | Die [[Rechner]] wurden als Komplettpaket mit umfangreicher [[Hardware]]ausstattung verkauft: Enthalten waren der eigentliche Rechner mit integrierter [[Tastatur]] und [[Laufwerk]] ([[Kompaktkassette]] beim CPC464 und 464Plus, 3″-[[Diskette]] bei den anderen Modellen), ein Farb- oder ein [[Monochrom]]-[[Monitor]] (grün bei den klassischen und schwarzweiß bei den Plus-Modellen) mit integriertem Netzteil, mehrere kurze Verbindungskabel, ein ausführliches Handbuch, eine [[CP/M]]-[[Booten|Bootdiskette]] sowie eine Diskette mit Programmen bzw. eine Demokassette. Ein Fernseher konnte über einen als Zubehör erhältlichen [[Adapter]] angeschlossen werden. Jedoch lieferte der mitgelieferte [[RGB]]-Monitor ein wesentlich besseres Bild als ein Fernseher. Je nach Modell und Ausstattung war der Verkaufspreis vergleichbar oder deutlich niedriger als der eines [[C64]], bei dem Monitor und Disketten-Laufwerk in der Regel als Zubehör erworben werden mussten. | ||
Version vom 14. Mai 2023, 09:06 Uhr
Die Amstrad-CPC-Serie, im deutschsprachigen Raum eher als Schneider CPC bekannt, war eine in den 1980er Jahren populäre Baureihe untereinander weitgehend kompatibler 8-Bit-Heimcomputer, die auf der damals weit verbreiteten Z80-CPU basierte und u. a. in Westeuropa größere Verbreitung fand. Entwickelt wurden die CPCs von der britischen Firma Amstrad, die sie in Fernost, u. a. von Orion, als Auftragsarbeit bauen ließ. Die Bezeichnung CPC leitet sich vom englischen Colour Personal Computer ab.
Die Rechner wurden als Komplettpaket mit umfangreicher Hardwareausstattung verkauft: Enthalten waren der eigentliche Rechner mit integrierter Tastatur und Laufwerk (Kompaktkassette beim CPC464 und 464Plus, 3″-Diskette bei den anderen Modellen), ein Farb- oder ein Monochrom-Monitor (grün bei den klassischen und schwarzweiß bei den Plus-Modellen) mit integriertem Netzteil, mehrere kurze Verbindungskabel, ein ausführliches Handbuch, eine CP/M-Bootdiskette sowie eine Diskette mit Programmen bzw. eine Demokassette. Ein Fernseher konnte über einen als Zubehör erhältlichen Adapter angeschlossen werden. Jedoch lieferte der mitgelieferte RGB-Monitor ein wesentlich besseres Bild als ein Fernseher. Je nach Modell und Ausstattung war der Verkaufspreis vergleichbar oder deutlich niedriger als der eines C64, bei dem Monitor und Disketten-Laufwerk in der Regel als Zubehör erworben werden mussten.
Da Amstrad in Deutschland über keine Vertriebsstrukturen verfügte, übernahm die Schneider Computer Division, eine eigens zu diesem Zweck gegründete Tochter der Schneider Rundfunkwerke AG, den Vertrieb unter der Bezeichnung Schneider CPC für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nachdem Amstrad und Schneider 1988 die Zusammenarbeit beendet hatten, verkaufte Amstrad auch in diesen Ländern die CPC-Serie unter eigenem Namen, was mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten verbunden war, da Amstrad bis zu diesem Zeitpunkt nach wie vor nicht selbst in Deutschland vertreten war. Deshalb und weil der Zenit der CPCs bereits überschritten war, stammen die meisten in Deutschland verkauften CPCs noch von Schneider. In den meisten anderen Ländern wurden CPCs bereits zuvor unter der Bezeichnung Amstrad CPC verkauft.
Technik, Ausrüstung und Bedienung
Die Technik entsprach durchgehend dem Stand der Zeit, und so war der Computer in den meisten Aspekten dem direkten Konkurrenten Commodore 64 ebenbürtig. In Teilbereichen (z. B. Anzahl darstellbarer Farben, Sprachumfang des eingebauten BASIC-Interpreters, Leistung der CPU, Speichermedien) war der CPC diesem sogar überlegen, in anderen (Fehlen von Hardware-Unterstützung für Sprites) dagegen unterlegen.
Der Rechner startete direkt ins (samt ausführlichem Handbuch) mitgelieferte, auf dem ROM enthaltene Locomotive BASIC. Weitere Software konnte über Kassette oder Diskette nachgeladen werden. Mit den beigelegten Disketten konnte das Betriebssystem CP/M 2.2, bei den Modellen mit 128 kB RAM auch CP/M 3.0, nachgeladen werden; weitere Programme und Programmiersprachen, etwa Logo und Turbo Pascal 3.01A waren erhältlich. Programmierung in Maschinensprache war mittels der üblichen Befehle vom BASIC aus direkt möglich, aber auch echte Assembler standen zur Verfügung.
Der BASIC-Editor des CPC wich vom reinen Bildschirmeditor-Konzept des direkten Konkurrenten C64 insofern ab, als eine an sich zwar nur zeilenorientierte, aber mit dem "Copy-Cursor" zur Übernahme vorhandener Bildschirminhalte dennoch recht komfortable Funktion zum Kopieren oder Editieren des Quelltextes bereitstand. Der für die Zeit komfortable BASIC-Interpreter wies einen recht guten Befehlsumfang auf. Module und Funktionen fehlten entsprechend der Entstehungszeit beinahe ganz, die automatisierte Bearbeitung des zeilennummerierten Listings (Neunummerierung, Verschmelzen einzelner Listing-Teile etc.) war möglich.
Nicht nur das BASIC, sondern auch das interne Betriebssystem (für Assembler-Programmierer) war im Vergleich zu anderen Heimcomputern schnell und geradezu luxuriös ausgestattet. So enthielt das ROM des CPC unter anderem eine umfangreiche Bibliothek für Gleitkommazahlen sowie ein ausgeklügeltes Interrupt-System, das teilweise sogar von BASIC aus nutzbar war (sogenannte Events).
Systeme
Spiele
Quellenangabe
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Amstrad CPC aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (Abgerufen: 26. März 2023, 19:22 UTC) und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. Dies ist eine gekürzte Variante des Originalartikels, den vollständigen Artikel findest du unter obigem Link. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar, dort kann man den Artikel bearbeiten.