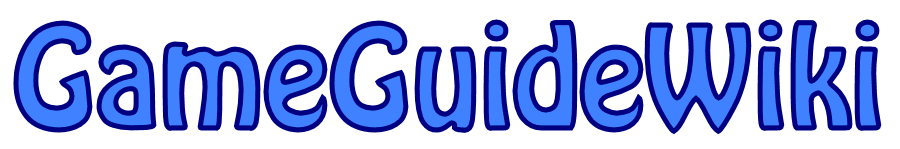2½D
Mit 2½D, 2,5D oder Pseudo-3D (bzw. mit Bindestrich: 2½-D oder in englischer Schreibweise: 2.5D) werden in verschiedenen technischen Bereichen, insbesondere jedoch in der Informatik, Darstellungsformen bezeichnet, die weder rein zweidimensional noch vollständig dreidimensional sind. Vor allem bei Videospielen ist die zweieinhalbdimensionale Darstellungsart weit verbreitet.
Während die ersten grafischen Spiele auf flachen 2D-Bildern basierten, ließen echte 3D-Spiele aufgrund begrenzter Hardwareleistung lange auf sich warten. Als Alternative nutzten Spieleentwickler verschiedene optische Techniken, um räumliche Tiefe zu simulieren. So entstanden die ersten 2½D-Spiele, die zwar dreidimensional wirkten, aber noch auf zweidimensionalen Prinzipien basierten.
Heutzutage ist echtes 3D technisch problemlos realisierbar, dennoch wird Pseudo-3D oft als veraltet angesehen. Darauf deutet auch schon der meist abwertend gebrauchte Vorsatz Pseudo- hin. Dabei kann eine vereinfachte 3D-Darstellung stilistisch gewollt und bewusst gewählt sein. Gerade bei weniger komplexen Spielen ermöglicht sie eine ressourcenschonende Umsetzung, ohne auf einen räumlichen Eindruck komplett zu verzichten.[1]
Techniken der Pseudo-3D-Darstellung
Die Umsetzung von Pseudo-3D in Videospielen erfolgte über eine Vielzahl an grafischen und technischen Kniffen. Zu den einfachsten und frühesten Methoden zählt das Parallax Scrolling, bei dem mehrere Hintergrundebenen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen, um Tiefe zu erzeugen – häufig in frühen Jump ’n’ Runs zu sehen. Ebenso trugen Schattierungen und Lichtverläufe zur Illusion räumlicher Tiefe bei, obwohl sie rein zweidimensional umgesetzt wurden.
In frühen Adventures oder Actionspielen wurden Bewegungen auf einer scheinbaren Z-Achse ermöglicht, also von vorne nach hinten durch das Bild, was durch Größenveränderung (Sprite-Scaling) simuliert wurde. Auch der Wechsel von Kameraperspektiven – etwa aus der Seitenansicht in eine schräge Draufsicht – verstärkte den 3D-Eindruck.
Komplexere Verfahren folgten mit der isometrischen Perspektive und der festen Vogelperspektiven, bei denen grafische Elemente so angeordnet wurden, dass ein räumlicher Aufbau entstand. In Dungeon Crawlern wie Eye of the Beholder wurde die Welt kachelbasiert mit festen 90°-Drehungen dargestellt – eine einfache, aber effektive Raumillusion.
Noch weiter gingen Techniken wie das Raycasting, bekannt aus Wolfenstein 3D oder Doom, bei dem aus einer zweidimensionalen Karte eine Echtzeit-Perspektive errechnet wurde. Ein weiterer Ansatz nutzte vorgerenderte Hintergründe kombiniert mit animierten Sprites im Vordergrund, die z.B. in Resident Evil oder Final Fantasy VII zum Einsatz kamen.
Mit zunehmender Rechenleistung wurde schließlich auch die Kombination aus echtem 3D-Rendering und klassischem 2D-Gameplay möglich, wie in modernen 2,5D-Plattformspielen à la Trine oder Little Nightmares, die den technisch ausgereiftesten Pseudo-3D-Ansatz darstellen.[1]
Unterscheidung am Beispiel von Actionspielen
In Actionspielen zeigt sich der Unterschied zwischen 2D, 2½D und 3D deutlich. Ein klassisches 2D-Actionspiel wie Mega Man lässt den Spieler in einer mehr oder weniger linear verlaufenden, seitlich scrollenden Welt agieren, wobei die Bewegung auf einer festen Ebene stattfindet. Im Vergleich dazu zeigt ein 2,5D-Spiel wie Rayman Legends ähnliche seitliche Bewegungen, jedoch mit einer optischen Tiefe und Perspektive, die der Welt einen 3D-Eindruck verleiht, ohne den grundlegenden 2D-Charakter zu verlieren. Ein 3D-Actionspiel wie Tomb Raider oder Assassin’s Creed geht einen Schritt weiter und bietet dem Spieler eine vollständig dreidimensionale Welt mit voller Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und der Möglichkeit, über Kamerasteuerung den Blickwinkel auf die Umgebung zu verändern.
Beispiele für 2½D-Spiele
Bereits im GameGuideWiki eingetragene 2½D-Spiele findet ihr in der Kategorie:2½D-Spiel.
Quellenangabe
- ↑ 1,0 1,1 2.5D Quelle: Wikipedia, Autor(en): Liste der Autoren, Abgerufen am 27.04.2025 (englisch)